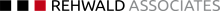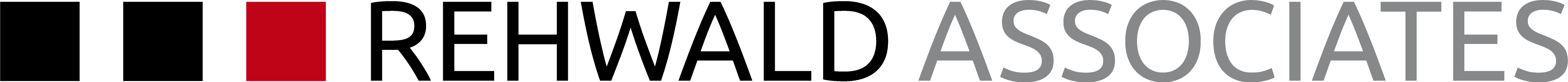Der große Drahtseilakt: Wie häufig Kandidaten in der Karriere wechseln sollten

Alle guten Dinge sind drei
„Ich halte es nicht für ratsam, alle 24 Monate zu wechseln und so in acht Jahren auf vier Arbeitgeber zu kommen“, sagt Headhunter Raphael Rosenfeld von Argos Advisors in München. Falls der Arbeitgeber den Mitarbeiter auch noch über einen Personalberater einstellt und dessen Honorar bezahlen müsse, würde so mancher Arbeitgeber sich gegen den Kandidaten entscheiden. „Alle gute Dinge sind drei“, meint Rosenfeld. „Wenn man alle drei Jahre wechselt, dann ist das in Ordnung. Es sollte aber immer eine gewisse Konstanz erkennbar sein.“
Drei Wechsel in drei Jahren hält Riske ebenfalls für einen guten Wert. Doch auch hierbei gilt es einiges zu beachten. „Wenn man ein, zwei kurze Stationen hinter sich hat, dann muss man sehr gut aufpassen, dass die dritte Station passt. Man muss mit der dritten Station die beiden kurzen Stationen gewissermaßen ausgleichen“, empfiehlt Riske. Diese dürfe dann auch schon mal fünf Jahre oder länger dauern.
„An irgendeiner Stelle sollten die Leute bewiesen haben, dass sie auch innerhalb einer Firma ein oder zwei Karriereschritte machen können“, ergänzt Rosenfeld. „Dies zeugt von Durchsetzungsvermögen innerhalb bestehender Strukturen als auch von Anerkennung gegenüber dem Mitarbeiter.“
Nach vielen Jahren bei demselben Arbeitgeber fällt der Wechsel schwieriger
Allerdings kann sich auch eine langjährige Unternehmenszugehörigkeit zu einem veritablen Karrierehindernis entwickeln. So beobachtet Rosenfeld immer wieder, dass es Kandidaten nach zehn Jahren in dem gleichen Großunternehmen schwer falle, sich in ein neues, vielleicht auch noch kleineres Unternehmen einzufinden.
Riske empfiehlt innerhalb von zehn Jahren mindestens einen Wechsel. Zwar gäbe es auch Arbeitnehmer, die bei einem Unternehmen voll zufrieden sind und alles klaglos laufe, doch ohne Wechsel würden Angestellte oftmals unwissend ein Risiko eingehen. Wenn es zu einer Restrukturierung komme und sich diese Mitarbeiter – aus welchen Gründen auch immer – neuorientieren müssten, dann werde ihnen die erforderliche Flexibilität abgesprochen.
„Ein Wechsel in zehn Jahren stellt eine Art von Versicherung dar. Man erwirbt neue Skills und zeigt, dass man eine gewisse Flexibilität mitbringt“, erläutert Riske. „Wenn man 20 Jahre bei demselben Institut verbracht hat, dann wird einem Kandidaten unterstellt, unflexibel geworden zu sein.“
Häufigkeit der Wechsel sollte im Karriereverlauf abnehmen
„Wenn jemand sich am Anfang seiner Karriere befindet, dann kann eine Station auch einmal etwas kürzer ausfallen; dann testet man noch etwas aus“, meint Riske.
Auch für Rosenfeld ist es vollkommen in Ordnung, wenn sich jemand nach zwei Jahren im ersten Job nach einer neuen Herausforderung umschaut. „Die Wechselhäufigkeit sollte im Lauf der Karriere abnehmen“, empfiehlt Rosenfeld.
Ein Wechsel muss sinnvoll sein
Headhunter Manuel Rehwald von Rehwald Associates in Königstein rät von Wechseln aus rein finanziellen Gründen ab: „Nur für ein bisschen mehr Geld sollten Kandidaten nicht wechseln – vor allem, wenn das Unternehmen schlechter dasteht oder Produkte mit mäßiger Performance anbietet.“ Ohnehin würden sich seit der Finanzkrise immer mehr Finanzprofis – darunter auch zunehmend Investmentbanker – einen Wechsel ganz genau überlegen. „Ich sehe den Trend, dass die Menschen immer seltener wegen des Geldes wechseln und immer stärker auf eine langfristige Perspektive achten“, sagt Rehwald. „Man sollte nur für einen Karriereschritt oder eine Lernkurve wechseln.“ Dies könne z.B. in der Übernahme von mehr Verantwortung oder dem Umgang mit neuen Produkten bestehen.
Die Wechselhäufigkeit hängt auch vom Profil ab
Laut Rehwald hänge es von der Tätigkeit ab, wie häufig ein Jobwechsel sinnvoll ist. So spiele Langfristigkeit und Loyalität im Wealth Management tendenziell eine größere Rolle als im Investmentbanking. Allerdings beobachte Rehwald auch dort die Tendenz zu einem längerfristigeren Engagement.
Ganz ähnlich sieht dies Riske: „Man findet deutliche Unterschiede zwischen der ‚General Industry‘ und ‚Financial Services‘.“ In der Finanzdienstleistungen fielen die Wechsel häufiger als in den übrigen Branchen aus. Auch steige die Wechselhäufigkeit in Sektoren, in denen ein Fachkräftemangel herrsche. „Wo mehr gesucht wird, wird auch mehr gewechselt“, beobachtet Riske. „Die Arbeitgeber fördern dies, indem sie den Kandidaten die große Karotte in Gestalt von mehr Geld unter die Nase halten.“
Das unterschätzte Risiko
Nach Riskes Erfahrungen würden viele Kandidaten das Risiko eines Jobwechsels unterschätzen. Sicher sei bei einem Wechsel ein Gehaltsaufschlag von 15 bis 20 Prozent üblich. „Allerdings handelt es sich dabei um eine Art Risikoprämie“, warnt Riske. Der neue Arbeitgeber könne in wirtschaftliche Schieflage geraten, es könnten Restrukturierungen anstehen, man selbst die Erwartungen nicht erfüllen oder einfach nur der Chef wechseln. „Letztendlich weiß man erst, woran man ist, wenn man bei dem Unternehmen angefangen hat“, gibt Riske zu bedenken. Wenn es bei dem neuen Arbeitgeber nicht wie erhofft laufe und man sich nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen müsse, dann habe man schon zwei Wechsel im Lebenslauf.
Der schwarze Peter liegt beim Kandidaten
„Wenn Sie zu häufig wechseln, dann müssen sie sich rechtfertigen“, warnt Riske. Auch wenn es gute Gründe für den Wechsel gebe, die mit der Persönlichkeit des Kandidaten nicht zusammenhingen, bleibe doch immer ein negativer Eindruck hängen. „Der Deutsche neigt dazu, eher skeptisch zu sein.“